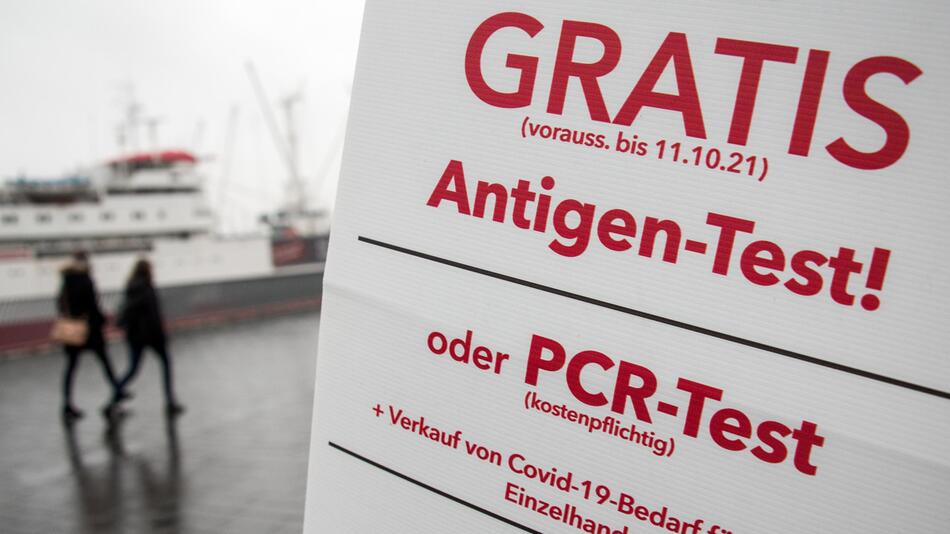- 20:55 Uhr: ➤ Drosten: Omikron-Subtyp BA.2 könnte deutlich ansteckender sein
- 18:31 Uhr: Patientenschützer werfen Lauterbach Versagen bei Einrichtungs-Impfpflicht vor
Drosten: Omikron-Subtyp BA.2 könnte deutlich ansteckender sein
Der Virologe Christian Drosten gibt zu bedenken, dass die Variante BA.2 von Omikron eine noch höhere Übertragbarkeit haben könnte als der derzeit in Deutschland vorherrschende Subtyp BA.1. Auf Basis neuer Daten aus Dänemark nehme er an, dass BA.2 möglicherweise einen sogenannten Fitnessvorteil und damit eine gesteigerte Übertragungsfähigkeit haben könnte, sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité am Dienstag im Podcast "Coronavirus-Update" bei NDR-Info.
Drosten erklärte den angenommenen Unterschied zwischen den beiden Subtypen mit der Metapher von zwei Autos und sagte mit Blick auf BA.2: "Der Motor, der hat schon ein paar PS mehr." Bei BA.1 hingegen sei er der Auffassung, dass die Variante der Immunantwort des Körpers ausweichen könnte, weshalb sie sich so schnell ausbreite.
Die Daten des dänischen Preprints deuteten darauf hin, dass das Infektionsrisiko bei BA.2 deutlich höher sei als bei BA.1. Das Risiko der Weitergabe des Virus ist demnach bei infizierten Ungeimpften ebenfalls stark erhöht, bei geimpften Kontaktpersonen allerdings verringert.
Der Anteil von BA.2 in Deutschland ist laut dem jüngsten Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland "nach wie vor sehr gering" mit 2,3 Prozent in der zweiten Woche des Jahres (Woche zuvor: 1,4 Prozent). Das RKI schreibt zu dem Subtyp: "International wird beobachtet, dass sich BA.2 stärker ausbreitet als BA.1". Das betreffe etwa Dänemark und das Vereinigte Königreich. Drosten sagte im Podcast, zwar werde der Anteil von BA.2 wohl auch in Deutschland steigen – wegen der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen aber vermutlich langsamer als in anderen Ländern. Genaueres sei wegen der geringen Datenlage aber noch nicht vorherzusagen.
Die weiteren Corona-News vom 1. Februar:
Norwegen lockert Corona-Maßnahmen kräftig
20:33 Uhr: Norwegen hebt einen Großteil seiner Corona-Maßnahmen auf. Bereits ab Dienstagabend um 23.00 Uhr gibt es unter anderem keine Begrenzungen für den Ausschank von alkoholischen Getränken mehr. Der Breitensport und andere Freizeitaktivitäten können nach Regierungsangaben ohne Einschränkungen wieder voll aufgenommen werden, Kinos, Theater und Kirchen können wieder voll besetzt sein. Teilnehmerbeschränkungen werden für Zusammenkünfte ebenso aufgehoben wie die Testpflicht für Einreisende.
Die Maskenpflicht in Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr und in anderen Situationen mit möglichem Gedränge bleibt dagegen bestehen, wie Ministerpräsident Jonas Gahr Støre am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz in Oslo sagte. Die generelle Ein-Meter-Abstandsregel bleibt ebenfalls bis auf Weiteres in Kraft.
"Heute sind wir endlich dorthin gekommen, dass wir viele der Infektionsschutzmaßnahmen aufheben können, mit denen wir den Winter über gelebt haben", sagte Støre. Man wisse nun, dass die Krankheitslast durch die Omikron-Variante des Coronavirus geringer sei und die Impfstoffe sehr vielen Menschen in Norwegen einen guten Schutz lieferten. Deshalb könne man viele Maßnahmen aufheben, obwohl die Neuinfektionszahlen schnell steigen. Um die Kontrolle zu behalten, müssten jedoch einige Maßnahmen bleiben.
Die norwegische Regierung strebt an, die letzten Beschränkungen bis zum 17. Februar aufzuheben - wenn sich die Lage wie erwartet weiter entwickelt.
Türkei meldet mit mehr als 100.000 Corona-Fällen neuen Höchststand
19:08 Uhr: Die Türkei hat zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie die Marke von 100.000 neuen Corona-Fällen an einem Tag überschritten. Das Gesundheitsministerium in Ankara meldete am Dienstagabend zudem 198 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in 24 Stunden. Die Türkei hat mit rund 84 Millionen Einwohnern eine ähnlich große Bevölkerung wie Deutschland. Beschränkungen im öffentlichen Leben bestehen zurzeit kaum. Dem Gesundheitsministerium zufolge sind rund 84 Prozent der über 18-Jährigen mindestens zweimal geimpft.
Das Land setzt den chinesischen Impfstoff Sinovac, den von Biontech/Pfizer sowie das selbst entwickelte Präparat Turkovac ein. Die Türkische Ärztevereinigung TTB kritisiert, dass zu wenige Daten zu dem einheimischen Impfstoff veröffentlicht worden seien. Wie in vielen anderen Ländern ist auch in der Türkei die hoch ansteckende Omikron-Variante dominierend.
Patientenschützer werfen Lauterbach Versagen bei Einrichtungs-Impfpflicht vor
18:31 Uhr: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Versagen bei der Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vorgeworfen. Bei der Neuregelung würden "die Vollzugsprobleme von Gesundheitsämtern, Ordnungsbehörden und Arbeitgeber ignoriert", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. "Noch verheerender ist jedoch, dass Karl Lauterbach die Versorgung von bis zu 200.000 Pflegebedürftigen und Kranken in Gefahr bringt. Eine Basta-Politik wird scheitern."
Wer in einer Gesundheit- oder Pflegeeinrichtung arbeitet, muss bis zum 15. März nachweisen, dass er genesen oder geimpft ist. Tut er das nicht, muss der jeweilige Arbeitgeber dies dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Das Bundesgesundheitsministerium wies am Dienstag darauf hin, dass die Gesundheitsämter in jedem Einzelfall über das weitere Vorgehen entscheiden müssten. Die Erklärungen des Ministeriums seien "keineswegs beruhigend", sagte Brysch dazu. Im Gesetz stehe ohnehin nicht, "dass am 16. März alle Ungeimpfte entlassen werden müssen".
Die Union forderte Lauterbach auf, die offenen Fragen zu klären. Die Bundesregierung dürfe sich "nicht wegducken und die Arbeitgeber mit dem Problem allein lassen", sagte Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Es zeigt sich, dass im Zusammenhang mit der bereichsspezifischen Impfpflicht eine Reihe von schwierigen Fragen auftaucht." Die Bundesregierung müsse diese endlich klären, forderte Frei.
Pflegerat für pragmatische Umsetzung von Einrichtungsimpfpflicht
17:51 Uhr: Der Deutsche Pflegerat hat sich für eine pragmatische Umsetzung der ab Mitte März greifenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht ausgesprochen und gleichzeitig grundsätzliche Kritik an dem Vorhaben geäußert. Pflegeratspräsidentin Christine Vogler plädierte für eine Risikoabwägung vor Ort durch das jeweilige Gesundheitsamt.
"Es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Es kann ja nicht ein Gesundheitsamt sagen, wir ziehen die Leute ab. Was machen wir dann mit den Pflegebedürftigen?", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.
Die einrichtungsbezogene Impfpflicht greift ab 16. März. Laut Infektionsschutzgesetz können die Gesundheitsämter demnach künftig nach einer gewissen Frist ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot für Beschäftigte von Kliniken oder Pflegeeinrichtungen aussprechen, wenn diese auch nach Aufforderung keinen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen oder kein Attest haben, das sie von einer Impfung befreit. Die Ämter kritisieren, dass die Einzelfallprüfung bei ihnen zu weiteren Belastungen führen wird.
Vogler übte grundsätzliche Kritik an der Regelung: "Die Gesellschaft muss begreifen, dass wir uns alle impfen müssen. Das kann nur gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. Bei der Gesamtsituation hilft uns die einrichtungsbezogene Impfpflicht überhaupt nicht. Den Fokus auf die Berufsgruppe der Pflegenden zu richten und ihnen den schwarzen Peter zuzuspielen, ist nicht gerechtfertigt."
Stattdessen sollte es ihrer Ansicht nach massive Aufklärungskampagnen und verstärkte Bemühungen für Impfungen geben oder auch eine allgemeine Impfpflicht. Im Pflegerat als Dachverband haben sich große Verbände der Pflegebranche zusammengeschlossen.
WHO warnt vor zu frühem Ende von Corona-Schutzmaßnahmen
17:35 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor dem verfrühten Ende von Corona-Schutzmaßnahmen. Es sei voreilig, das Virus für besiegt zu halten, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf.
Seit dem Auftauchen der Omikron-Variante vor etwa zehn Wochen seien fast 90 Millionen neue Infektionen gemeldet worden - mehr als im ganzen Jahr 2020. "Wir sehen jetzt einen sehr besorgniserregenden Anstieg der Todeszahlen in den meisten Weltregionen."
Die WHO sei besorgt, dass manche Regierungen es nicht mehr für nötig hielten, das Infektionsrisiko weiter durch Vorschriften wie Maske tragen oder Abstand halten zu reduzieren. Dies werde damit begründet, dass die Impfraten relativ hoch seien und Omikron sehr viele Menschen anstecke, aber wenig schwere Krankheitsverläufe verursache.
Das sei völlig falsch, sagte Tedros. "Dieses Virus ist gefährlich, und es verändert sich weiter direkt vor unseren Augen."
Länder mit hohen Impfraten und guten Gesundheitssystemen könnten sich allerdings bald dem Ende der akuten Phase der Pandemie nähern, sagte WHO-Notfallkoordinator Mike Ryan. Doch müsse jede Regierung ihre Impfrate sowie die Immunität innerhalb der Bevölkerung nach durchgemachter Infektion und die Stärke des Gesundheitswesens in Betracht ziehen. Besonders gefährdete Menschen sollten weiter Masken tragen - auch, wenn dies nicht mehr vorgeschrieben sei.
Vor Impfpflicht: 12.000 Pflegekräfte melden sich arbeitssuchend
16:48 Uhr: Die Bundesagentur für Arbeit stellt vor der Einführung einer einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen Bewegung auf dem Arbeitsmarkt fest. Aus dem Gesundheits- und Sozialsektor hätten sich im Dezember und Januar 25.000 mehr Menschen arbeitssuchend gemeldet als üblich, sagte Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach am Dienstag in Nürnberg.
Arbeitssuchend sind Menschen, die eine drohende Arbeitslosigkeit bei der Arbeitsagentur anzeigen, aber noch im Job sind, erläuterte ein Sprecher der Bundesagentur. Eine Impfpflicht im Gesundheits- und Sozialwesen soll am 16. März in Kraft treten.
"Wir sehen schon eine Zunahme, aber insgesamt auf einem Niveau, was uns allen keine Sorgen machen muss", sagte Terzenbach. Er sprach von etwa 25.000 Personen aus dem gesamten Gesundheits- und Sozialsektor, die sich über das übliche Niveau hinaus arbeitssuchend gemeldet hätten, davon ungefähr 12.000 aus der Pflege.
Ob die erhöhte Zahl unter anderem auf entsprechende Aufrufe in sozialen Medien zurückzuführen ist, sei derzeit nicht bekannt.
Clubs und Discos dürfen in Katalonien am 11. Februar wieder öffnen
16:31 Uhr: In Katalonien mit der Touristen-Metropole Barcelona können Einheimische und Besucher bald wieder das Nachtleben genießen: Diskotheken, Clubs und andere Nachtlokale dürfen am Freitag nächster Woche nach einer coronabedingten, knapp sechswöchigen Zwangsschließung wieder öffnen. Dies teilte die Regierung der Region im Nordosten Spaniens am Dienstag mit. Dann ist auch kein COVID-Pass mehr erforderlich.
Katalonien hatte erst jüngst die 3G-Regel (also: geimpft, genesen oder getestet) für das Betreten vieler öffentlicher Innenräume sowie auch die Begrenzungen bei der Auslastung von Gaststätten und anderen Veranstaltungsorten aufgehoben. Sie ist aber bis zum 11. Februar die einzige der 17 Regionen Spaniens, in der das Nachtleben noch geschlossen ist.
Seit Tagen werden die Corona-Maßnahmen überall in Spanien deutlich gelockert oder abgeschafft. Man habe den Höhepunkt der derzeitigen vor allem von der Omikron-Variante ausgelösten Corona-Welle überschritten, so das Gesundheitsministerium. Noch herrscht aber landesweit Maskenpflicht, auch im Freien.
Die Sieben-Tage-Inzidenz in dem beliebten Urlaubsland ist seit ihrem Höchststand Mitte Januar (1.657) um etwa 500 Punkte gefallen. Der Druck auf das Gesundheitssystem nimmt wieder ab. Auch wegen der hohen Impfquote weisen die meisten der Infizierten keine oder nur milde Krankheitssymptome auf. Fast 81 Prozent der Bevölkerung wurden mindestens zwei Mal geimpft und sind damit grundimmunisiert.
CDU-Gesundheitsexperte fordert Klarheit bei Einrichtungsimpfpflicht
16:24 Uhr: Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge (CDU), hat von der Bundesregierung Klarheit bei der ab Mitte März geltenden Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und der Pflege gefordert. "Die Bundesregierung hat viele arbeitsrechtliche und praktische Fragen unbeantwortet gelassen", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Damit die Impfpflicht im Gesundheitswesen kein Fehlschlag werde, müsse die Regierung jetzt schnellstens Klarheit schaffen.
Sorge forderte Gesundheitsminister
Die Ämter, die laut Infektionsschutzgesetz die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen durchsetzen sollen, sehen sich mit der Kontrolle überfordert.
Man rechne damit, dass im Schnitt bei fünf bis zehn Prozent der Mitarbeiter kein eindeutiger Nachweis oder kein vollständiger Impfschutz vorliege und eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolge, hatte Elke Bruns-Philipps, die stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der "Rheinischen Post" gesagt. "Das ist eine erhebliche Belastung mit der Prüfung jedes Einzelfalls, wie es jetzt vorgesehen ist, die die Gesundheitsämter nicht zeitnah bewältigen können", kritisierte sie.
Schulze: Deutschland will Afrika bei Impfstoffproduktion unterstützen
16:01 Uhr: Deutschland will in vier afrikanischen Ländern den Aufbau von Corona-Impfstoffproduktionen unterstützen. Gerade in Afrika müsse Impfstoff hergestellt werden können, auch wenn das kompliziert sei, sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag nach einem Besuch der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf. Deutschland wolle beim Aufbau von Impfstoffproduktionen in Südafrika, Ghana, Ruanda und Senegal helfen.
Eine Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe sieht
Deutschland engagiere sich intensiv in der EU-Partnerschaft für eine gerechte Impfstoffverteilung und den Aufbau von Produktionskapazitäten in Entwicklungsländern, sagte Schulze. Die Corona-Impfstoffe selbst seien heutzutage nicht mehr knapp. Es gehe jetzt um die Logistik der Impfkampagne, um die Versorgung mit Schutzausrüstung wie Handschuhen sowie um funktionierende Kühlketten, damit die Impfstoffe zu den Menschen kämen.
"Wir müssen eine weltweite Impfkampagne organisieren", sagte Schulze. Davon hänge auch die Sicherheit in Deutschland ab. In Europa liegt die Impfquote nach früheren Angaben von Schulze bei 70 Prozent, auf dem afrikanischen Kontinent unter zehn Prozent.
Deutsches Marine-Schiff kann wegen Corona-Fällen nicht an Nato-Einsatz teilnehmen
15:41 Uhr: Wegen Corona-Fällen unter der Besatzung kann das deutsche Marine-Schiff "Berlin" vorerst nicht an einem Nato-Einsatz vor Norwegen teilnehmen. Der Einsatzgruppenversorger sei nicht wie geplant am Dienstagmittag aus Wilhelmshaven ausgelaufen, teilte die Deutsche Marine auf Twitter mit. Grund seien 14 Besatzungsmitglieder, die bei einem PCR-Test positiv auf Corona getestet worden seien.
Die "Berlin" sollte sich dem Nato-Marineverband Standing Maritime Group 1 anschließen. Er ist laut Marine vor allem für die Kontrolle und den Schutz strategisch wichtiger Seewege in Nordatlantik und Nordsee zuständig.
Die "Berlin" sollte dabei gut zwei Monate auf See bleiben und an Manövern und Übungen teilnehmen. Dabei geht es insbesondere um das Manöver "Cold Response" vor Norwegen.
Nach Angaben der Marine von vergangener Woche sollte auch der niederländische Leiter des Nato-Verbands mit seinem Stab an Bord der "Berlin" kommen und von dort aus die Schiffe führen. Der deutsche Versorger mit einer 210-köpfigen Besatzung sollte dann Mitte April nach Wilhelmshaven zurückkehren.
Sachsen lockert mehr Beschränkungen als geplant
15:22 Uhr: Sachsen lockert mit seiner neuen Corona-Notfallverordnung mehr Beschränkungen als ursprünglich geplant. "Was wir heute machen, ist nichts weiter als ein Gleichziehen", sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) mit Blick auf bereits erfolgte Erleichterungen in anderen Bundesländern.
So soll in Gaststätten künftig nur noch die 2G-Regel (genesen oder geimpft) statt 2G plus mit einem zusätzlichen Test gelten. Bei Großveranstaltungen kann die Platzkapazität draußen ohne eine Obergrenze zu 25 Prozent ausgelastet werden.
Bei Versammlungen fällt die maximale Teilnehmerzahl von derzeit 1.000 weg. Bei Eheschließungen und Begräbnissen dürfen statt 20 Personen nun 50 teilnehmen, sofern sie genesen, geimpft oder getestet sind (3G). Die Lockerungen gelten solange, wie die Überlastungsstufe in Krankenhäusern nicht erreicht ist.
FDP-Fraktionschef: Parlament sollte über Genesenenstatus entscheiden
15:12 Uhr: FDP-Fraktionschef
Mitte Januar hatten Bundestag und Bundesrat eine Änderung der sogenannten COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung beschlossen. Mit ihr wurde ein neues Verfahren eingeführt: Genesenen-Nachweise müssen demnach Kriterien entsprechen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) auf einer Internetseite bekannt macht - sie gelten dann unmittelbar.
Auf Basis dieser Neuregelung war der Genesenenstatus überraschend auf eine Zeitspanne von 28 bis 90 Tagen nach einem positiven PCR-Test verkürzt worden. Kritisiert wird unter anderem, dass die erfolgte Änderung durch das RKI vorher nicht angekündigt wurde.
"Die Gesundheitsminister haben darüber beraten und nun festgestellt, dass dieses Verfahren nicht sinnvoll ist. Das nehmen wir sehr ernst", sagte Dürr. "Wenn die Gesundheitsminister sich mehrheitlich dafür aussprechen, sollten wir diese Regelung ändern."
Sachsen lässt mehr Fans in die Stadien: Auslastung 25 Prozent
14:24 Uhr: Sachsen lässt mit seiner neuen Corona-Verordnung wieder mehr Fans in die Stadien. Wie Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung mitteilte, können die Stadion wieder zu 25 Prozent der Platzkapazität gefüllt sein.
Eine Obergrenze gilt dabei nicht, größere Arenen können also mehr Zuschauer einlassen als kleinere. Nach dieser Regelung könnten im Stadion von Fußball-Bundesligist RB Leipzig rund 11.000 Fans bei Spielen dabei sein.
Bei den Zweitligisten Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue sind es etwa 8.000 beziehungsweise 4.000. Zu Veranstaltungen in Hallen sind maximal 2.000 Zuschauer bei einer 50-prozentigen Auslastung möglich. Die Regelung gilt, solange die Überlastungsstufe in Krankenhäusern nicht überschritten wird.
Nach der bisherigen Notfall-Verordnung waren in sächsischen Stadien maximal 1.000 Gäste zugelassen. RB Leipzig ging dagegen vor. Das nächste Heimspiel der Leipziger steht am 11. Februar gegen den 1. FC Köln an.
Ob das Sächsische Oberverwaltungsgericht jetzt noch über den Eilantrag zu entscheiden hat oder RB auf die Ankündigung der Regierung reagiert, blieb zunächst offen. Laut Innenminister Roland Wöller (CDU) hatte der Eilantrag des Bundesligisten beim OVG keinen Einfluss auf die Kabinetts-Entscheidung.
Niedersachsen fördert PCR-Testgeräte in Apotheken
13:56 Uhr: Niedersachsen will den Engpass bei den PCR-Tests zur Corona-Diagnose mit zusätzlichen Testgeräten in den Apotheken lindern. Apotheken, die ein PCR-Testgerät anschaffen, können ab sofort 80 Prozent des Kaufpreises vom Land erstattet bekommen, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Insgesamt stelle das Land dafür drei Millionen Euro bereit, pro Apotheke stehen bis zu 3.000 Euro zur Verfügung. Nach Angaben des Ministeriums ist Niedersachsen das erste Bundesland mit einer solchen Förderung.
Bisher verfügten erst rund 250 der 1.700 Apotheken im Land über PCR-Testgeräte, erklärte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Die bereitgestellte Fördersumme reicht für mindestens 1.000 weitere Apotheken. Behrens erhofft sich eine Steigerung der Testkapazität um knapp 20 Prozent - das entspreche rund 50.000 Tests pro Woche.
Studien: Impfung verringert Risiko von Long-COVID-Beschwerden erheblich
13:31 Uhr: Den besten Schutz gegen SARS-CoV-2 bieten derzeit Corona-Schutzimpfungen. Eine hundertprozentige Garantie gibt es allerdings auch für vollständig Geimpfte nicht, Impfdurchbrüche sind immer möglich. Eine Infektion verläuft aber in der Regel milder. Außerdem verringern Impfungen gegen das Virus Studien zufolge das Risiko von Long-COVID-Beschwerden erheblich.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Bar-Ilan University in Israel haben zum Beispiel herausgefunden, dass geimpfte Personen, die sich mit dem Virus infiziert haben, deutlich weniger der typischen Long-COVID-Symptome aufweisen als Ungeimpfte.
Bei sieben von zehn Symptomen wurde festgestellt, dass Personen mit zwei Impfungen ein um 50 bis 80 Prozent geringeres Risiko hatten, diese Beschwerden zu bekommen, als diejenigen ohne Schutz. Daten von Personen mit lediglich einer Impfung liegen nicht vor. Außerdem hatten geimpfte Patienten vier bis elf Monate nach einer Infektion nicht mehr Symptome als andere, die nie mit dem Virus infiziert waren.
Eine zweite Studie der britischen Statistikbehörde ONS kommt zu ähnlichen Ergebnissen: Teilnehmer der "Coronavirus (COVID-19) Infection Survey (CIS)", die einen Impfdurchbruch hatten, litten zwölf Wochen nach der Infektion mit einem um 41 Prozent reduzierten Risiko an Beschwerden im Vergleich zu Ungeimpften.
Auch schwere Long-COVID-Symptome, die Betroffene in ihrem Alltag einschränken, wurden bei Geimpften seltener festgestellt.
Kretschmann will vor Ostern nicht über Corona-Lockerungen reden
13:09 Uhr: Baden-Württenbergs Ministerpräsident
So habe Baden-Württemberg vor kurzem erst Regeln verschärft, sagte Kretschmann mit Blick auf die FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Das werde man nicht durch "haltlose Ausstiegsdebatten" konterkarieren. Man sei immer noch in einer dramatischen Situation.
Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt im Südwesten in nur 5 von 44 Stadt- und Landkreisen unter 1.000. Auf den Intensivstationen im Land werden derzeit 274 COVID-Erkrankte behandelt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, liegt bei 4,8. Es gebe derzeit etwa viele Klagen von überlasteten Arztpraxen, sagte Kretschmann.
Laborverband: Mehr als vier von zehn PCR-Tests positiv
12:49 Uhr: Der Anteil der positiv ausgefallenen Laboruntersuchungen auf das Coronavirus ist laut einem Laborverband erneut auf einen Höchstwert gestiegen. Vorige Woche sei eine "historisch hohe" Positivrate von 41,1 Prozent erfasst worden, sagte der erste Vorsitzende des Verbands Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM),
In Hinblick auf die Auslastung von 95 Prozent sagte Müller: "Wir sind am Limit". In vielen Bundesländern ist die Kapazität laut Verband bereits erschöpft. Nachdem die bundesweite Testkapazität vorige Woche bei rund 2,5 Millionen gelegen hatte, wird sie für die laufende Woche mit etwa 2,6 Millionen angegeben. Es handle sich um hohe Kapazitäten, die für den medizinischen Bedarf ausreichend seien, sagte Müller. Es sei wichtig, die Tests sinnvoll und anlassbezogen einzusetzen.
Die Daten basieren laut ALM auf Angaben von rund 180 Laboren und stellen etwa 90 Prozent des Testgeschehens in Deutschland dar. Zu privat bezahlten PCR-Tests lägen dem Verband keine Daten vor, sagte Müller.
Zahl der Sterbefälle in Tschechien 2021 auf Höchststand
12:20 Uhr: Auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens sind 2021 so viele Menschen gestorben wie in keinem anderen Jahr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es wurden mehr als 139.600 Todesfälle registriert, ein Anstieg um acht Prozent gegenüber dem ersten Corona-Pandemiejahr 2020, wie die Statistikbehörde CSU am Dienstag in Prag mitteilte. Am stärksten betroffen war demnach die Altersgruppe der 55- bis 74-Jährigen.
Eine besonders hohe Übersterblichkeit im Vergleich zu den letzten fünf Jahren vor der Pandemie habe sich in den Monaten Januar, Februar, März, November und Dezember gezeigt. Den Angaben zufolge starben insgesamt deutlich mehr Männer als Frauen.
Auf dem Höhepunkt der dritten Corona-Welle im März 2021 hatte das deutsche Nachbarland einen vorübergehenden harten Lockdown mit Bewegungsbeschränkungen verhängt. Nach Meinung mancher Experten kam die Entscheidung aber zu spät. Bei der Impfung gegen COVID-19 hinkt das Land bis heute den westlichen EU-Staaten hinterher. Aktuell sind 63,2 Prozent der Bevölkerung vollständig grundimmunisiert. Rund ein Drittel der Bevölkerung hat zusätzlich eine Auffrischimpfung erhalten.
Bundesländer trotz Corona mit leichtem Haushaltsplus
11:38 Uhr: Die Bundesländer haben trotz anhaltender Corona-Pandemie im vergangenen Jahr einen leichten Haushaltsüberschuss erzielt. Insgesamt erwirtschafteten sie in ihren Kernhaushalten (ohne mögliche Extrahaushalte) ein Plus von rund 800 Millionen Euro, wie das Finanzministerium im Internet veröffentlichte. Zuerst berichtete am Dienstag das "Handelsblatt" über die Zahlen. Im ersten Pandemie-Jahr 2020 hatten die Länder noch ein Minus von mehr als 40 Milliarden Euro eingefahren und erhebliche Summen in Extrahaushalte für die Pandemiebekämpfung gesteckt.
Grund für die bessere Finanzlage waren zum einen höhere Steuereinnahmen, zum anderen aber auch Bundes-Zahlungen im Rahmen der Corona-Hilfspakete. Während die Länder ein leichtes Plus einfuhren, machte der Bund im vergangenen Jahr zur Bekämpfung der Pandemie hohe Schulden von rund 215 Milliarden Euro.
Zwar erzielten neun Bundesländer im vergangenen Jahr ebenfalls ein Minus, das wurde aber kompensiert von den Überschüssen der anderen sieben Länder. So erreichte Hessen ein Plus von 2,4 Milliarden Euro, Rheinland-Pfalz von fast 2,3 Milliarden. Baden-Württemberg fuhr fast 1,5 Milliarden ein, Bayern rund 900 Millionen. Das größte Defizit gab es in Nordrhein-Westfalen mit 3,5 Milliarden Euro.
Experten: Vorsicht in Sachen Lockerungen von Corona-Maßnahmen
11:19 Uhr: In der Debatte um mögliche Lockerungen von Corona-Maßnahmen in Deutschland raten Fachleute zu Vorsicht. "Eine Exit-Strategie zu planen, um sie später bereitliegen zu haben, ist gut und vernünftig. Aber die Politik sollte nichts überstürzen", sagte der Virologe Friedemann Weber von der Universität Gießen. "Wenn man solche Pläne vorbereitet, muss man den Menschen auch immer klar dazu sagen, dass es noch zu nicht absehbaren Entwicklungen kommen könnte, die die Umsetzung verzögern."
Kritik kommt von Max Geraedts, der das Institut für Versorgungsforschung und Klinische Epidemiologie an der Philipps-Universität Marburg leitet. Die Diskussion sende "viel zu früh" die Botschaft, dass die Pandemie schon vorbei sei. "Stattdessen werden wir in den nächsten Wochen an vielen Stellen erleben, dass Personal in allen Branchen entweder isoliert oder in Quarantäne ist, so dass es zu Einschränkungen des Alltags kommt."
"Wir stehen vor einem weiteren Anwachsen der Infektionswelle. Je nach weiterer Entwicklung könnten möglicherweise sogar erst einmal weitere Einschränkungen sinnvoll sein", teilte die Infektiologin Jana Schroeder (Stiftung Mathias-Spital, Rheine) auf Anfrage mit. "Wir müssen eine gewisse Demut walten lassen bei all den Dingen, die wir bisher nicht über COVID-19 wissen, insbesondere durch Omikron." Sie verwies zum Beispiel auf Long COVID, Folgen möglicher wiederholter Infektionen und begrenzte Therapieoptionen. Schroeder hält Vorsicht für angebracht, eine politische Auseinandersetzung mit einem Lockerungsplan sei aber dennoch sinnvoll: "Aufmachen ist schwieriger als zumachen."
In der Diskussion hatte auch die Bundesregierung am Montag auf die Bremse gedrückt und darauf verwiesen, dass die Omikron-Welle ihren Höhepunkt noch nicht erreicht habe. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet diesen für Mitte Februar. Am 16. Februar sind auch die nächsten Corona-Krisenberatungen von Bund und Ländern geplant. Nach Ansicht von FDP-Chef und Bundesfinanzminister
Corona: Handel befürchtet Aus für fast 16.000 Geschäfte
10:50 Uhr: Der Handelsverband Deutschland (HDE) befürchtet, dass durch die Auswirkungen der Corona-Krise in diesem Jahr noch einmal fast 16.000 Geschäften das Aus droht. Vor allem die innerstädtischen Händler litten auch 2022 noch unter den Nachwirkungen der Pandemie, warnte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Dienstag in Berlin. Besonders belastend für die Händler sei die 2G-Regelung, wonach in großen Teilen des Handels nur Geimpfte und Genesene einkaufen dürfen.
Nach einer aktuellen Umfrage des Verbandes unter 1.300 Handelsunternehmen schätzen 46 Prozent der von der 2G-Regelung betroffenen Händler ihre Geschäftslage als schlecht ein. "Diese im Kampf gegen die Pandemie nutzlose Maßnahme muss endlich bundesweit fallen", forderte Genth. Außerdem machten vielen Händlern die anhaltenden Lieferschwierigkeiten zu schaffen. Massiv betroffen seien davon vor allem Sportartikel, Elektronik und Haushaltswaren.
Wenn die Auswirkungen der Pandemie zeitnah nachlassen und Maßnahmen wie 2G für den Handel zurückgenommen werden, rechnet der HDE für die Branche trotz aller Probleme in diesem Jahr aber insgesamt mit einem Umsatzplus von drei Prozent. Damit würden die Umsätze im Einzelhandel auf mehr als 600 Milliarden Euro steigen. Das Gros des Wachstums dürfte allerdings erneut aus dem Online-Bereich kommen, für den der HDE ein Wachstum von 13,5 Prozent prognostiziert.
75,8 Prozent der Bevölkerung bis Ende Januar gegen Corona erstgeimpft
10:30 Uhr: Bis einschließlich Montag, dem letzten Tag des Monats, haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 75,8 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Das Ziel der Bundesregierung, bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona zu impfen, ist damit endgültig verfehlt worden. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte dies bereits am Montag eingeräumt. Ursprünglich wollte die Regierung diese Quote sogar bereits bis zum 7. Januar erreichen.
Das Impftempo verlangsamte sich weiter. Rund 200.000 Spritzen wurden nach RKI-Angaben am Montag verabreicht. Am Montag davor waren es noch rund 348.000, zwei Wochen zuvor, am 17. Januar, sogar knapp 473.000. Die meisten der am Montag verabreichten Spritzen waren den Angaben zufolge Auffrischungsimpfungen (rund 143.000) - es gab 39.000 Zweitimpfungen und 18.000 Erstimpfungen.
Über einen vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze verfügen nach RKI-Angaben 61,6 Millionen Menschen (74 Prozent). Mindestens 44,1 Millionen Menschen (53 Prozent) haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten. Mindestens eine Impfdosis haben den Angaben zufolge 63 Millionen Menschen bekommen.
Das RKI weist grundsätzlich seit längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Eine hundertprozentige Erfassung durch das Meldesystem könne nicht erreicht werden. Das RKI geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt als auf dem Dashboard angegeben.
Südafrika schafft Corona-Restriktionen weitgehend ab
09:45 Uhr: Südafrika hat angesichts einer mittlerweile abgeebten vierten Infektionswelle die meisten seiner Corona-Maßnahmen abgeschafft. Die Schulen kehren ohne die bisherige Distanzregel zurück zum normalen Unterricht. Zudem müssen positiv geteste Personen ohne Symptome nach dem Beschluss der Regierung vom späten Montagabend künftig nicht mehr in Quarantäne.
Für solche mit Symptomen wurde die Dauer der Isolierung von zehn Tagen auf sieben Tage verkürzt. Wer Infizierten nahegekommen ist, muss nach diesen neuen Beschlüssen zudem nur noch in Quarantäne, falls Symptome auftreten. Weiterhin Bestand haben jedoch die Maskenpflicht und allgemeine Hygieneregeln.
Begründet wurden die Lockerungen mit Studien, wonach in Südafrika rund 70 Prozent der Bevölkerung bereits eine Infektion hatten. Am Montag wurden in dem Kap-Staat mit seinen knapp 60 Millionen Einwohnern nur noch 1.366 Neuinfektionen gemeldet. Erste Erkenntnisse deuteten zudem auf einen eher milden Krankheitsverlauf der Coronavirus-Variante Omikron im Vergleich zur Delta-Variante hin. Südafrika befindet sich nun auf der niedrigsten Stufe eines fünfstelligen Alarmsystems. Forderungen nach seiner gänzlichen Abschaffung haben sich in den vergangenen Wochen gemehrt.
Südafrika gilt mit mehr als 3,6 Millionen registrierten Infektionen sowie gut 95.000 Toten seit dem Ausbruch der Pandemie als das zahlenmäßig am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land auf dem afrikanischen Kontinent.
Auch die Wirtschaft des Kap-Staates ist schwer getroffen: Die Arbeitslosenquote lag Ende vergangenen Jahres bei offiziell 34,9 Prozent. Nimmt man diejenigen hinzu, die die Suche nach einem Arbeitsplatz aufgegeben haben, liegt sie sogar bei 44,6 Prozent.
Unter den mittlerweile weitgehend aufgehobenen Reisebeschränkungen vieler Länder ist vor allem der wichtige Tourismussektor betroffen, der in Südafrika knapp zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt und Hunderttausende Jobs sichert.
Homeoffice-Quote steigt erneut - Potenzial längst nicht ausgeschöpft
09:10 Uhr: Die Zahl der Beschäftigten im Homeoffice ist im Januar leicht gestiegen. Das geht aus einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts hervor. Demnach arbeiteten 28,4 Prozent der Beschäftigten zumindest zeitweise von zu Hause aus, nach 27,9 Prozent im Dezember. Den Angaben zufolge liegt die Quote damit aber noch gut drei Prozentpunkte unter dem Höchstwert aus dem März 2021.
Klarer Spitzenreiter in Sachen Heimarbeit ist nach wie vor der Dienstleistungssektor mit einem Anteil von 39,2 Prozent, wie das Ifo am Dienstag mitteilte. Das ist ein Prozentpunkt mehr als im Vormonat. IT-Dienstleister und Unternehmensberater arbeiten dabei mit jeweils über 70 Prozent mit Abstand am häufigsten zu Hause.
Insgesamt liegt der Anteil der Beschäftigten in Heimarbeit damit aber deutlich unter dem vom Ifo-Institut errechneten Potenzial von 56 Prozent. "Nicht alle Unternehmen beachten offenbar die Ende November wieder eingeführte Homeoffice-Pflicht", sagte Jean-Victor Alipour, Experte für Homeoffice beim Ifo-Institut, laut Mitteilung.
Andreas Bovenschulte will einheitliche Länderlinie bei Lockerungen
08:46 Uhr: Der Bremer Bürgermeister
"Wir brauchen vereinheitlichte Regeln für den Einzelhandel in Deutschland", sagte Bovenschulte. Nach seiner Vorstellung sollte der Zugang zu Geschäften nur für Geimpfte und Genesene (2G) aufgehoben und durch eine durchgehende Maskenpflicht ersetzt werden.
Bei Großveranstaltungen brauche es Augenmaß, um "in begrenztem Umfang Zuschauerinnen und Zuschauer zuzulassen". Aber gerade in diesem Punkt sei das Vorgehen der Länder sehr unterschiedlich. "Bisher war es nicht möglich, sich auf eine gemeinsame Linie zu einigen."
WHO: Pandemie führt zu riesigem Berg an Medizinmüll
08:14 Uhr: Infolge der Corona-Pandemie haben sich nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen weltweit mehr als als 200.000 Tonnen medizinischen Abfalls angehäuft - vieles davon Plastikmüll. Die UN-Organisation mit Sitz in Genf forderte am Dienstag Strategien, um Mensch und Umwelt vor schlecht entsorgten Schutzanzügen, Test-Kits und Impf-Utensilien zu schützen.
Nach Angaben der WHO fielen durch die Milliarden Impfungen seit Beginn der Pandemie mindestens 144.000 Tonnen an gebrauchten Nadeln, Spritzen und Sammelbehältern an. Hinzu kommen 87.000 Tonnen Schutzbekleidung, die allein von den Vereinten Nationen zwischen März 2020 und November 2021 ausgeliefert wurden. In Corona-Tests stecken bis zu 2.600 weitere Tonnen an Müll und 731.000 Liter an chemischen Abfällen. Schutzmasken für den Privatgebrauch sind in den Schätzungen nicht eingerechnet.
Schon vor der Pandemie waren nach Angaben der WHO ein Drittel aller Gesundheitseinrichtungen nicht in der Lage, ihren Müll fachgerecht zu entsorgen. Die zusätzlichen COVID-Abfälle seien ein Gesundheits- und Umweltrisiko für medizinisches Personal sowie für Menschen, die in der Nähe von Deponien leben, hieß es.
Die WHO drängt nun auf umweltfreundlichere Verpackungen, wiederverwendbare Schutzbekleidung und Investitionen in Recyclingsysteme. "COVID-19 hat der Welt die Lücken und Versäumnisse bei der Produktion, Verwendung und Entsorgung von Gesundheitsprodukten aufgezeigt", sagte Maria Neira, die bei der WHO für Umweltfragen zuständig ist.
Impfpflicht für Pflegeberufe: Patientenschützer fordern Aufschub
07:47 Uhr: Die Stiftung Patienschutz fordert eine Verschiebung der Corona-Impfpflicht für Beschäftigte von Kliniken und Pflegeheimen. "Die Impfpflicht für medizinisch-pflegerische Berufe darf nicht mit der Brechstange eingeführt werden", sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse die Sorgen vor Ort ernst nehmen.
"Gesundheitsämter, Ordnungsbehörden und Arbeitgeber sehen sich nicht in der Lage, das Mammutwerk bis zum 15. März ohne schwere Verwerfungen durchzusetzen", sagte Brysch. Lauterbach müsse wissen, dass die Versorgung von bis zu 200.000 Pflegebedürftigen und Kranken in Gefahr sei. "Ein Aufschub ist dringend geboten."
Das von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz legt fest, dass Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März nachweisen müssen, dass sie gegen Corona geimpft oder vor einer Infektion genesen sind - oder ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Arbeitgeber müssen die Gesundheitsämter informieren, wenn dies nicht geschieht. Diese beklagen aber, mit der Kontrolle überfordert zu sein.
Einreiseregeln nach Thailand wieder gelockert - Strafen bei Vergehen
07:19 Uhr: Touristen, die den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben, können ab sofort wieder quarantänefrei nach Thailand einreisen. Das im Dezember aus Angst vor einer Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus ausgesetzte "Test&Go"-Modell wurde am Dienstag wieder aufgenommen, weil die Viruszahlen in dem beliebten Urlaubsland in den vergangenen Wochen nicht dramatisch angestiegen sind. Jedoch wurden die Regeln verschärft - und bei Zuwiderhandeln drohen Geldstrafen.
Statt nur einen PCR-Test nach der Ankunft in Thailand machen zu müssen, ist jetzt ein weiterer PCR-Test am fünften Tag nach der Ankunft erforderlich. Während die Feriengäste auf das Testergebnis warten, müssen sie sich in einem spezialisierten Hotel isolieren. Alle in Deutschland verwendeten Impfstoffe werden anerkannt, darunter auch Kreuzimpfungen. Es gelten weitere Regeln, und es wird dringend empfohlen, sich bei den Behörden genau zu informieren.
Wer die Vorgaben der Behörden missachte, müsse mit einer Geldbuße von bis zu 20.000 Baht (530 Euro) rechnen, sagte der Sprecher des COVID-Krisenzentrums CCSA, Taweesilp Wisanuyothin. "Touristen müssen die Gesetze Thailands befolgen." Strafen in anderen Ländern der Region seien viel härter, betonte er. Wer keine entsprechende Krankenversicherung habe, müsse zudem alle Kosten für eine eventuelle COVID-Behandlung und Quarantäne selbst tragen.
Die Regierung in Bangkok hatte Ende Dezember aus Angst vor steigenden Fallzahlen wegen Omikron beschlossen, das "Test&Go"-Modell zunächst auf Eis zu legen. Zuletzt mussten Einreisende je nach Herkunftsland und Impfstatus wieder sieben oder zehn Tage in Quarantäne. Lediglich auf den größten Inseln Phuket und Ko Samui sowie in weiteren Provinzen wie Krabi und Phang-nga konnten Urlauber weiter mittels des so genannten Sandbox-Modells unter bestimmten Auflagen quarantänefrei Ferien machen.
Am Dienstag meldeten die Behörden rund 7.400 Neuinfektionen. Thailand mit seinen Inseln, Stränden, Tempeln und Dschungeln ist auf den Tourismus angewiesen und hofft auf eine Erholung der Branche. Vor Corona kamen jährlich etwa 40 Millionen internationale Gäste.
Spargelbauern planen Impfangebote für osteuropäische Erntehelfer
06:50 Uhr: Die Spargel- und Beerenanbauer in Deutschland wollen für ihre osteuropäischen Erntehelfer Impfangebote auf den Höfen anbieten. Entsprechende Planungen liefen bereits, sagte der Geschäftsführer des Netzwerks der Spargel- und Beerenverbände, Frank Saalfeld, am Montag. "Wir haben schon eine Krankenkasse, mit der wir zusammenarbeiten."
Im Moment suche man noch nach Partnern, die Impfbusse zur Verfügung stellten. Es gebe auch noch Fragen zum Impfstoff. "Es lohnt sich nicht, jemanden, der für zwei oder drei Monate hier ist, mit Biontech zu impfen, weil er damit keinen vollständigen Impfschutz bekommt." Es bleibe der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem es aber noch viel Klärungsbedarf gebe.
RKI registriert 162.613 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.206,2
06:24 Uhr: Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals die Schwelle von 1.200 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1.206,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.176,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 894,3 (Vormonat: 220,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 162.613 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05:25 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 126.955 Ansteckungen.
Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.
Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 188 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 214 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 9 978 146 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.
Die Zahl der in Kliniken gekommenen mit Corona infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 4,64 an (Freitag 4,72). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.
Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstagmorgen mit 7.705.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 117.974.
24 weitere Corona-Fälle vor Olympia in Peking
06:00 Uhr: Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking haben die Organisatoren 24 weitere Corona-Fälle festgestellt. Wie das Organisationskomitee am Dienstag mitteilte, wurden am Montag 18 Einreisende positiv auf das Coronavirus getestet, darunter elf Athleten oder Teammitglieder. Zudem wurden bei sechs Personen, die sich bereits im geschlossenen Olympia-System befinden, Infektionen registriert. Am Vortag hatte es insgesamt 37 positive Tests gegeben, die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist seit dem 23. Januar auf insgesamt 200 gestiegen.
Für die Olympischen Winterspiele in Peking gilt ein strenges Corona-Sicherheitskonzept. Alle Beteiligten - von Athleten bis hin zu Journalisten - sind vollständig vom Rest der chinesischen Bevölkerung getrennt. Um Infektionen möglichst rasch zu erkennen, muss jeder Teilnehmer innerhalb der Olympia-Blase täglich einen PCR-Test absolvieren.
Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.
Die Volksrepublik China verfolgt eine strenge "Null COVID"-Strategie, bei der bereits kleinere Infektionsstränge mit harten Maßnahmen bekämpft werden. In den vergangenen Wochen haben die Behörden in mehreren Millionenstädten im Land Lockdowns verhängt.
Neue Corona-Regeln für Reisende nach Italien
05:41 Uhr: In Italien gelten seit Dienstag weitere Corona-Regeln, die auch Reisende betreffen. Wer aus anderen EU-Staaten kommt, braucht entweder einen negativen Corona-Test, einen Impfnachweis oder eine Bescheinigung, genesen zu sein. Zuvor galt wegen der grassierenden Omikron-Variante für alle - egal, ob geimpft oder genesen - auch eine Testpflicht. Ungeimpfte mussten fünf Tage in Quarantäne.
Seit Anfang Januar hat Italien eine Corona-Impfpflicht für Menschen, die älter als 50 Jahre sind. Nun müssen Ungeimpfte dieser Altersgruppe eine Strafe von 100 Euro bezahlen, wenn sie erwischt werden. Vom 15. Februar an können sie auch nicht mehr an ihren Arbeitsplatz: Dort gilt dann die 2G-Regel - also geimpft oder genesen.
Änderungen gibt es auch beim Einkaufen. Am Dienstag trat für Geschäften, die nicht zum täglichen Bedarf gehören, die 3G-Regel in Kraft. In Buchhandlungen, Banken oder Ämtern braucht man also zumindest einen negativen Test. Ausgenommen sind etwa Supermärkte oder Apotheken.
In dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern sind fast 81 Prozent der Gesamtbevölkerung gegen COVID-19 geimpft. Die täglichen Corona-Fallzahlen gingen zuletzt zurück. Am Montag meldeten die Behörden rund 57.700 Neuinfektionen und annähernd 350 Virus-Tote.
Gesundheitsämter sehen sich mit Kontrolle der Impfpflicht überfordert
04:46 Uhr: Die Gesundheitsämter sehen sich nicht in der Lage, die zum 15. März in Kraft tretende Corona-Impfpflicht für Beschäftigte von Kliniken und Pflegeheimen angemessen zu kontrollieren. Man rechne damit, dass im Schnitt bei fünf bis zehn Prozent der Beschäftigten kein eindeutiger Nachweis oder kein vollständiger Impfschutz vorliege und eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolge, sagte Elke Bruns-Philipps vom Bundesverband der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Das ist eine erhebliche Belastung mit der Prüfung jedes Einzelfalls, wie es jetzt vorgesehen ist, die die Gesundheitsämter nicht zeitnah bewältigen können."
Das von Bundestag und Bundesrat im Dezember beschlossene Gesetz legt fest, dass Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März nachweisen müssen, dass sie gegen Corona geimpft oder vor einer Infektion genesen sind - oder ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Arbeitgeber müssen die Gesundheitsämter informieren, wenn dies nicht geschieht. Diese müssen dann jeden Einzelfall unter die Lupe nehmen.
"Es ist grundsätzlich ein Verfahren mit erneuter Fristsetzung des Gesundheitsamtes zur Vorlage von Impfdokumenten und einer Anhörung vorgesehen. Das bedeutet, dass es einer Prüfung jedes Einzelfalls bedarf", erläutert Bruns-Philipps. Die Beschäftigten dürfen damit zunächst einmal weiterarbeiten. Das Gesundheitsamt entscheide "über das weitere Vorgehen und die zu ergreifenden Maßnahmen im Rahmen seines Ermessens", sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums dem "Business Insider".
Grünen-Experte dämpft Hoffnungen auf baldige Corona-Lockerungen
02:00 Uhr: Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hält Lockerungen der Corona-Maßnahmen in den kommenden vier Wochen eher für unwahrscheinlich. In einem Interview der Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag) begründete er dies mit Unsicherheiten rund um den Omikron-Subtyp BA.2, eine womöglich noch leichter übertragbare Untervariante von Omikron.
"Es ist möglich, dass sich die Trendwende um mehrere Wochen verzögern könnte", sagte Dahmen den Funke-Zeitungen. Die BA.2-Verbreitung werde den Höhepunkt der aktuellen Welle voraussichtlich weiter nach hinten verschieben. "Alles, was wir bislang über BA.2 wissen, legt nahe, dass die Infektionszahlen möglicherweise noch nicht im Februar zurück gehen werden. Es ist möglich, dass sich die Trendwende um mehrere Wochen verzögern könnte."
Dabei spielten viele Faktoren eine Rolle. "Unklar ist zum Beispiel noch, wie gut Personen, die eine Infektion mit dem Omikron-Subtyp BA.1 überstanden haben, auch gegen BA.2 immunisiert sind." Das Virus werde Ende Februar nicht verschwunden sein. "Angesichts von BA.2 sind umfassende Lockerungen in den nächsten vier Wochen eher unrealistisch", sagte Dahmen.
EU-Impfnachweise ohne Booster nur noch neun Monate gültig
00:01 Uhr: Reisen ohne Booster-Impfung in der EU ist für viele Menschen nun deutlich schwieriger. Denn die EU-Impfnachweise sind seit Dienstag ohne Auffrischungsimpfung nur noch rund neun Monate (270 Tage) gültig. Nach Ablauf dieser Frist werden Menschen ohne diesen zusätzlichen Schutz bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt.
Das bedeutet in der Regel, dass sie bei grenzüberschreitenden Reisen in der EU einen aktuellen negativen Test brauchen oder sogar in Quarantäne müssen. "Dies spiegelt den nachlassenden Schutz des Impfstoffs wieder und unterstreicht, wie wichtig eine Auffrischung ist", sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders.
Der Impfnachweis besteht aus einem QR-Code, der direkt nach der Impfung etwa in Praxen und Impfzentren erstellt wird. Der Code ist in einer Smartphone-App darstellbar und kann digital ausgelesen werden. Die Codes werden trotz verschiedener Apps der einzelnen Länder überall in der EU anerkannt und erleichtern auf Reisen Nachweise nicht nur über Impfungen, sondern auch über frische Tests und kürzlich überstandene Infektionen mit dem Coronavirus.
"Mit den neuen Vorschriften für Reisen innerhalb der EU werden die unterschiedlichen Vorschriften in den Mitgliedstaaten harmonisiert", heißt es von Seiten der EU-Kommission. Wie lange die Grundimmunisierung in den jeweiligen Ländern - etwa für Restaurantbesuche oder Veranstaltungen - anerkannt wird, kann sich jedoch weiterhin unterscheiden.
In Deutschland gibt es zurzeit keine Regelung, die die Anerkennungsdauer von Impfnachweisen begrenzt. Menschen mit Booster-Impfung können aber unter Umständen von Testpflichten befreit sein.
Die EU-Staaten werden lediglich aufgefordert, ihre nationalen Regelungen anzupassen. Wenn sie das nicht machen, drohen aber auch keine unmittelbaren Strafen. Die EU-Absprachen haben aber politisch Bedeutung, so fachten sie jüngst eine Debatte um die Gültigkeitsdauer des Genesenenstatus in Deutschland an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigt eine umstrittene Verkürzung von sechs auf drei Monate. In einer Absprache auf EU-Ebene einigten sich die EU-Länder jedoch darauf, dass dieser Status für Reisen 180 Tage anerkannt werden soll.
Mehr zum Themenkomplex Coronavirus:
- Das sind die wichtigen Begriffe der Coronavirus-Pandemie
- Gesammelte Faktenchecks rund um das Coronavirus und COVID-19
- Händewaschen: Diese Fehler gilt es zu vermeiden