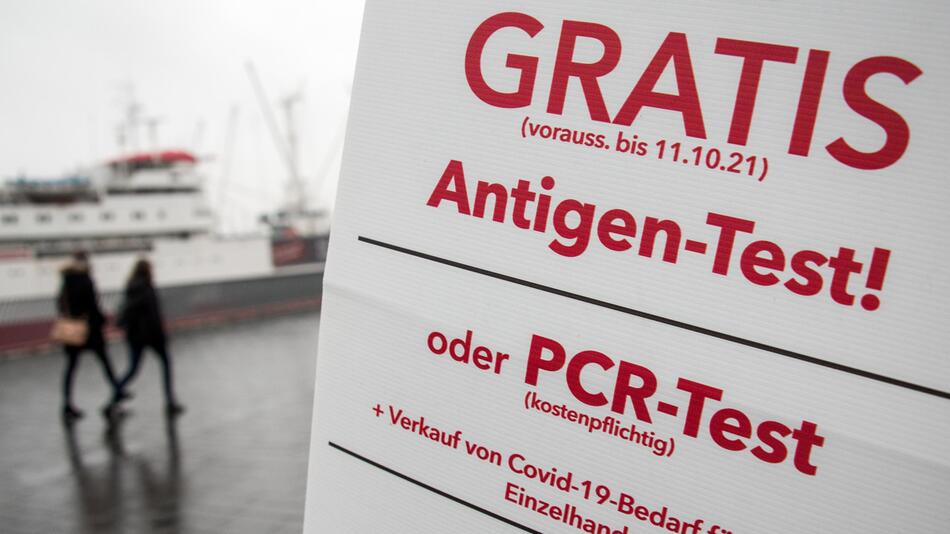- 22:00 Uhr: ➤ Österreich: Allgemeine Impfpflicht tritt in Kraft
- 16:44 Uhr: Fraktionsübergreifender Entwurf zur allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren liegt vor
- 14:34 Uhr: Nach Vertuschungs-Vorwürfen: Christian Drosten findet klare Worte
- 13:09 Uhr: Priorisierung von PCR-Tests rückt näher
- 12:35 Uhr: Baden-Württemberg prescht vor: Feldversuch zu Impfregister
- 12:29 Uhr: WHO: empfohlener Antikörper-Cocktail zeigt keine Wirkung bei Omikron
- 11:58 Uhr: Gericht: Welcher Elternteil bei Streit über die Corona-Impfung des Kindes entscheiden darf
➤ Österreich: Allgemeine Impfpflicht tritt in Kraft
20:37 Uhr: In Österreich tritt am Samstag die allgemeine Corona-Impfpflicht in Kraft. Die Alpenrepublik ist EU-weit das erste Land mit einer derartigen Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie. Die Impfpflicht, gegen die es im Vorfeld viele Demonstrationen gab, gilt für alle Menschen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Wer dagegen verstößt, soll Strafen von 600 bis 3.600 Euro zahlen müssen.
Ausnahmen sind laut Gesetz für Schwangere und diejenigen vorgesehen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Auch Genesene sind für 180 Tage von der Impfpflicht befreit. Zudem gibt es eine "Schonfrist" für alle: Kontrolliert werden soll die Einhaltung der Impfpflicht erst ab Mitte März.
Die weiteren Corona-News des Tages:
USA: Mehr als 900.000 Corona-Tote
23:37 Uhr: Seit Beginn der Pandemie sind in den USA mehr als 900.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das ging am Freitag aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervor. Die Schwelle von 800.000 Toten war erst Mitte Dezember überschritten worden.
Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt meist einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen. In Einzelfällen wurden die Zahlen aber auch wieder nach unten korrigiert. Der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge waren bis Donnerstag gut 892.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Kein Land hat mehr Corona-Tote registriert als die Vereinigten Staaten, in denen rund 330 Millionen Menschen leben.
Die Omikron-Welle traf die USA im Dezember mit voller Wucht. Die Fallzahlen schnellten Mitte Dezember in die Höhe und brachen Rekorde. Allerdings stieg die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle nicht im gleichen Maße an. Zuletzt ging die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA deutlich zurück. Im Durchschnitt der vergangen Tagen starben aber immer noch rund 2.400 Menschen täglich im Zusammenhang mit Corona. Nur im vergangenen Winter war dieser Wert noch höher.
Mehrere hundert Apotheken wollen kommende Woche mit Impfungen starten
17:23 Uhr: Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände rechnet damit, dass in der kommenden Woche bundesweit mehrere hundert Apotheken mit den Corona-Impfungen starten werden. "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der impfenden Apotheken sukzessive aufwächst. Eine vierstellige Zahl hat bereits bei ihrer jeweiligen Landesapothekerkammer gemeldet, dass sie die personellen, räumlichen und versicherungstechnischen Voraussetzungen zum Impfen erfüllen", sagte Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung am Freitag. In ganz Deutschland gibt es rund 18.500 Apotheken.
Insgesamt hätten mittlerweile gut 6.000 Apothekerinnen und Apotheker die notwendige Schulung absolviert. Voraussetzungen für die Impfungen sind eine mehrstündige theoretische und praktische Ausbildung durch einen Arzt und ein abgetrennter Behandlungsraum in der Apotheke. Möglich sind dabei sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen. Das Angebot ist freiwillig und als Ergänzung zu den Impfangeboten in Arztpraxen und Impfzentren gedacht. Die COVID-19-Impfung ist die erste Impfung, die Apotheken bundesweit anbieten können.
Fraktionsübergreifender Entwurf zur allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren liegt vor
16:44 Uhr: Das Konzept mehrerer Bundestagsabgeordneter für eine Impfpflicht ab 18 sieht eine Befristung der Maßnahme bis Ende kommenden Jahres vor. Geplant ist zudem eine dreifache Impfung, wie aus dem AFP am Freitag vorliegenden Eckpunktepapier für den Gesetzentwurf hervorgeht. Des weiteren sieht der Entwurf vor, dass die Menschen selbst einen Impfstoff auswählen können - und zwar zwischen allen zugelassenen Impfstoffen.
Die "Impfnachweispflicht gegen SARS-CoV-2" soll den Eckpunkten zufolge für alle Erwachsenen ab 18 Jahre mit dauerhaftem Aufenthalt in Deutschland gelten. "Sonderkonstellationen und erleichternde Ausnahmen werden wissenschaftsbasiert über eine Verordnung geregelt", heißt es in dem Eckpunktepapier weiter. Dazu gehöre unter anderem die Frage, inwieweit Genesungen berücksichtigt werden sollen, sowie medizinisch eindeutig begründete Ausnahmen.
Dem Papier zufolge sollen die Krankenkassen beauftragt werden, ihre Versicherten über die Abläufe und Beratungsangebote informieren "und Impfnachweise anzufordern sowie versichertenindividuell zu speichern". Es werde dafür "den Krankenkassen eine technische Lösung (Impfportal) zur Verfügung gestellt, um die Impfnachweise datensparsam und -geschützt sammeln zu können", heißt es in den Eckpunkten weiter.
"Wir wollen das Wissen, das wir haben, nutzen, um vor die Welle zu kommen", sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), die zuerst über die Eckpunkte berichtet hatten.
Schmidt ist eine von sieben Initiatorinnen und Initiatoren, die alle aus den Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP kommen. Weitere Unterstützer sind Heike Baehrens, Dirk Wiese (beide SPD), Janosch Dahmen, Till Steffen (beide Grüne) sowie Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Katrin Helling-Plahr (beide FDP). Die Tür zur Mitarbeit für Abgeordnete aus anderen Fraktionen stehe offen, sagte Schmidt.
Wird der Nachweis nicht erbracht, soll ein Bußgeldverfahren mit Fristsetzung eingeleitet werden. Dann haben die Betroffenen aber zunächst noch die Möglichkeit, das Bußgeld mit einer Impfung oder einem "nachholenden Nachweis" abzuwenden.
Neben der Impfpflicht ab 18 werden derzeit auch Anträge für eine Verpflichtung ab 50 sowie ein Nein zur Impfpflicht vorbereitet. Über die Entwürfe soll in der Bundestags-Sitzungswoche ab dem 14. Februar beraten werden, einen Monat später könnte es dann beschlossen werden.
Umfrage: Mehrheit hält Corona-Politik für nicht nachvollziehbar
15:44 Uhr: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hält die Corona-Politik der neuen Bundesregierung laut einer Civey-Umfrage für nicht nachvollziehbar. In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts für den Fernsehsender Welt gaben 56 Prozent der Befragten an, die Corona-Politik eher nicht oder eindeutig nicht nachvollziehbar zu finden. 22 Prozent hielten sie hingegen für eher oder eindeutig nachvollziehbar. Weitere 22 Prozent waren in ihrer Einschätzung ambivalent und bewerteten die Nachvollziehbarkeit mit "teils/teils".
Gefragt wurde außerdem, wie die Bürgerinnen und Bürger Bundeskanzler
Nach Vertuschungs-Vorwürfen: Christian Drosten findet klare Worte
14:34 Uhr: Der Virologe
Zuvor war neben dem Interview mit dem Nanowissenschaftler Wiesendanger im "Cicero" auch eines mit ihm in der "Neuen Zürcher Zeitung" erschienen. In beiden führte der Forscher in mehreren Punkten seine Theorie aus, SARS-CoV-2 stamme aus einem Labor in Wuhan. Führenden internationalen Virologen wie Drosten, die von einem Ursprung des Virus aus dem Tierreich ausgehen, warf er bewusste Irreführung und Vertuschung vor.
Eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) war in einem Bericht zur Herkunft des Coronavirus zu dem Schluss gekommen, die Theorie, das Virus könne mit einem Labor-Vorfall zu tun haben und sei somit künstlichen Ursprungs, sei "extrem unwahrscheinlich".
Wiesendanger, der an der Universität Hamburg arbeitet, vertritt schon länger eine gegensätzliche Position. Vor rund einem Jahr sorgte er mit einer Untersuchung für Schlagzeilen, in der er zum Ergebnis kam, dass sowohl Zahl als auch Qualität der Indizien für einen Labor-Unfall am virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der Pandemie sprächen. In der Kritik stand nicht zuletzt die Methodik der Arbeit – als Quellen nutzte er beispielsweise auch Youtube-Videos.
Die "Cicero"-Redaktion reagierte zunächst ihrerseits mit einem Tweet auf Drostens Kritik. "Wir halten die Kategorisierung unseres Gesprächspartners als "Extremcharakter" in diesem Kontext für nicht weiterführend", hieß es. Man biete an, ein Streitgespräch zwischen Wiesendanger und Drosten zu organisieren und zu dokumentieren.
Priorisierung von PCR-Tests rückt näher
13:09 Uhr: Die geplante Priorisierung von PCR-Tests rückt näher. Entsprechende Änderungen der Corona-Testverordnung sind in den letzten Abstimmungen zwischen Bund und Ländern, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag erfuhr. Ein Entwurf, der vom Bundesgesundheitsministerium an Länder und Verbände verschickt wurde, sieht wie geplant vor, dass Labore künftig vorrangig Proben von Risikogruppen, Beschäftigten in Kliniken, Praxen, in der Pflege und in Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung untersuchen sollen.
Wer zu einer Risikogruppe oder zu den genannten Beschäftigtengruppen gehört, wird das voraussichtlich mit einem ärztlichen Attest beziehungsweise einer Mitarbeiterbescheinigung nachweisen müssen. Beim Test soll das dann entsprechend vermerkt werden, so dass das Labor die Probe bevorzugt untersucht. Andere Personengruppen wären damit zwar nicht von PCR-Tests ausgeschlossen, es könnte aber sein, dass sie durch die Priorisierung länger auf ihr Ergebnis warten müssen.
Entfallen soll für die große Masse zumindest vorübergehend der Anspruch auf einen PCR-Bestätigungstest nach einem positiven Corona-Schnelltest. "Eine regelhafte bestätigende PCR-Testung" werde "zunächst ausgesetzt", heißt es in dem Entwurf. Nach der momentan noch gültigen Verordnung besteht dieser Anspruch nach einem positiven Selbst- oder Schnelltest an einer Teststation. Er soll den Plänen zufolge aber jederzeit wieder in Kraft gesetzt werden können, wenn das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite dafür eine Empfehlung ausspricht.
Nicht geregelt wird in der Verordnung das Thema Genesenen-Nachweis, für den bisher ein positiver PCR-Test nötig ist. In einem dem Entwurf beigefügten Anschreiben heißt es, der Bund strebe bei dem Thema eine zeitnahe Einigung mit den Ländern an.
Baden-Württemberg prescht vor: Feldversuch zu Impfregister
12:35 Uhr: Mit Blick auf die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht will Baden-Württemberg erproben, wie ein Impfregister aufgebaut werden könnte. Es liefen derzeit erste Gespräche für ein Modellprojekt beziehungsweise einen Feldversuch, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag mit. Details sind noch unklar. Die Frage nach einem Impfregister für alle Bürgerinnen und Bürger sowie die damit verbunden Fragen müssten gemeinsam auf Bundesebene geklärt werden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.
"Leider kommt das Thema im Bund nicht schnell genug voran. Deshalb wollen wir nicht länger warten, sondern selbst aktiv werden und unsere Konzepte und Erkenntnisse beisteuern", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). "Klar ist für mich: Ein Impfregister ist ein wichtiges Element der Verwaltungsmodernisierung und durch die Möglichkeit der Verknüpfung mit digitalen Patientenakten ein zentraler Baustein zur Digitalisierung des Gesundheitswesens."
Ministerpräsident
WHO: empfohlener Antikörper-Cocktail zeigt keine Wirkung bei Omikron
12:29 Uhr: Ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bislang empfohlener Antikörper-Cocktail hilft nach neuen Studien nicht bei Corona-Patienten, die mit der Omikron-Variante infiziert sind. Es handelt sich dabei um die Kombination von Casirivimab und Imdevimab. "Es sieht danach aus, dass dieser Antikörper-Cocktail mangelnde Wirksamkeit gegen Omikron zeigt", sagte Janet Diaz, WHO-Expertin für die Behandlung von COVID-19, am Freitag in Genf. Die Richtlinien der WHO über den Einsatz würden im Laufe des Februars entsprechend angepasst.
Die WHO hatte die Präparate für zwei Patienten-Kategorien empfohlen: Solche, die infiziert und noch nicht schwer krank sind, aber ein hohes Risiko haben, ins Krankenhaus zu müssen - etwa Ältere, Vorerkrankte und Ungeimpfte. Ebenfalls empfohlen wurden die Präparate für schwer kranke COVID-19-Patienten, die keine Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt haben.
Gericht: Welcher Elternteil bei Streit über die Corona-Impfung des Kindes entscheiden darf
11:58 Uhr: Bei gravierenden Meinungsverschiedenheiten über eine Corona-Impfung von Kindern kann die Entscheidung durch einen richterlichen Beschluss auf den Elternteil übertragen werden, der sich an die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) hält. Das entschied ein Familiengericht in Bad Iburg in Niedersachsen unter Verweis auf die etablierte entsprechende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) in dieser Frage. Dabei muss aber auch der Kindeswille beachtet werden.
In dem am Freitag veröffentlichen Beschluss ging es um einen Streit zwischen geschiedenen Eheleuten mit zwei Kindern im Alter von zwölf und 14 Jahren. Laut Gericht hatten sich Mutter und Vater zunächst darauf verständigt, bei der Frage der Coronaimpfung die Empfehlung der behandelnden Kinderärztin als Maßstab zu nehmen. Später lehnte die Mutter deren Empfehlung ab und blockierte eine Impfung generell.
Vor diesem Hintergrund übertrug das Familiengericht am Bad Iburger Amtsgericht die Entscheidung per Beschluss vom Januar auf den Vater. Dies entspreche de Rechtsprechung des BGH zur Frage von Impfungen bei Kindern im Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht auf Basis der Bestimmungen im Bürgerlichen Gesetzbuch. Sofern bei dem betroffenen Kind keine besonderen Impfrisiken vorlägen, müsse die Entscheidung grundsätzlich auf den Elternteil übertragen werden, der die Stiko-Impfempfehlung beachte.
Eine derartige allgemeine Impfempfehlung liege für Kinder ab zwölf Jahren im Fall von Corona vor, betonte das Gericht. Auch der eigene kindliche Wille müsse bei der Klärung von Sorgerechtsstreitigkeiten beachtet werden - allerdings laut Rechtslage nur dann, wenn dieses "im Hinblick auf sein Alter und seine Entwicklung auch eine eigenständige Meinung zum Gegenstand des Sorgerechts bilden kann".
Sei ein Kind wegen eines "auf Angst und Einschüchterung abzielendes Verhaltens eines Elternteils" nicht in der Lage, sich eine eigene Meinung zu Nutzen und Risiken einer Coronaschutzimpfung zu bilden, stehe sein Willen der Übertragung der Entscheidung auf eines seiner Elternteile auch nicht entgegen, erklärte das Gericht weiter.
Stiftung Patientenschutz verlangt vom Bund Fianzierung des Corona-Bonus
11:12 Uhr: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat die Bundesregierung aufgefordert, selbst das Geld für den geplanten Corona-Bonus für Pflegekräfte aufzubringen. "Der Staat verzichtet allein auf Steuereinnahmen bei den Prämien", sagte er der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Die Boni-Zahlungen müssten aber von den Arbeitgebern aufgebracht werden. Doch viele Krankenhäuser, Pflegeheime und ambulante Dienste seien dazu nicht in der Lage.
"Schließlich schreiben die Hälfte der Kliniken und immerhin ein Viertel der Pflegeeinrichtungen rote Zahlen", sagte Brysch. Zwar bezeuge die Ampel im Koalitionsvertrag den Pflegekräften eine herausragende Leistung in der Pandemie. Doch Rot-Gelb-Grün sei nicht bereit, die Corona-Prämien selbst aufzubringen. "So nimmt die Regierung in Kauf, dass viele Beschäftigte leer ausgehen."
Die Koalition müsse den Pflegebonus jetzt aus Haushaltsmitteln garantieren. "Alles andere führt im Gesundheitswesen sonst zum Fiasko." Anders als jetzt habe die Vorgängerregierung 2020 dafür gesorgt, dass die Corona-Boni in der Altenpflege zum größten Teil von der Pflegeversicherung getragen wurden. Für die Krankenhäuser zahlten zum Teil die Krankenkassen.
Der am Donnerstag bekannt gewordene Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister
Spanien hebt kommende Woche Maskenpflicht im Freien auf
10:53 Uhr: In Spanien sollen ab kommender Woche keine Corona-Schutzmasken mehr im Freien getragen werden müssen. Dies sagte am Freitag Gesundheitsministerin Carolina Darias in einem Rundfunkinterview. Die Lockerung solle ab kommenden Dienstag gelten.
Spanien hatte die Maskenpflicht Ende Dezember auch im Freien wieder angeordnet. Damit sollte die bereits sechste Corona-Welle im Land eingedämmt werden, die von der hochansteckenden Omikron-Variante getrieben wurde.
Inzwischen habe sich die Lage aber wieder gebessert, sagte Darias und verwies auf die aktuell günstige Krankenhausbelegung und Infektionsraten. In Spanien sind zudem mehr als 90 Prozent der Menschen über zwölf Jahren geimpft.
"Wichtigste Aufgabe der Politik": Kassenärzte-Chef Gassen fordert Freedom-Plan
10:00 Uhr: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat in der Debatte um Corona-Schutzmaßnahmen einen Öffnungsplan für Deutschland verlangt. "Was wird jetzt brauchen, ist ein Freedom Plan – ein Plan, wie wir schrittweise und an Parametern orientiert lockern", sagte Gassen der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Diesen Freedom Plan zu formulieren, ist nun wichtigste Aufgabe der Politik."
Deutschland müsse lernen, mit Corona zu leben, sagte Gassen weiter. "Manche meinen, die Pandemie sei erst vorbei, wenn keiner mehr an Corona stirbt. Das ist ein Irrtum: Corona wird wohl dauerhaft Teil des Krankheitsgeschehens bleiben." Bei der Influenza gebe es auch stets neue Varianten, in manchen Jahren Zehntausende Tote. "Das müssen wir auch bei Corona akzeptieren und zugleich weiter Impfungen für Risikogruppen anbieten", sagte Gassen weiter.
Konkret kann sich der KBV-Chef eine Öffnung der Stadien vorstellen: "Fußball findet vor allem draußen statt, hier wird man bald wieder zunehmend vollere Stadien zulassen können." Auch im Handel hält Gassen Lockerungen rasch für möglich: "2G im Handel brauchen wir bald auch nicht mehr, da stimme ich unserem Finanzminister Lindner zu."
Angesichts der überwiegend milden Verläufe bei den Erkrankungen mit der Omikron-Variante und Lockerungen in anderen Ländern werden die Forderungen nach baldigen Erleichterungen auch hierzulande lauter. Die Bundesregierung hat es aber abgelehnt, bereits jetzt einen Öffnungsplan zu erstellen.
Wegen Corona: Krebssterblichkeit dürfte steigen
08:45 Uhr:Weil die Zahl der Krebsbehandlungen und Krebsoperationen in der Corona-Pandemie gesunken ist, erwartet die Deutsche Krebshilfe zum nächsten Jahreswechsel eine erhöhte Krebssterblichkeit. Der Vorstandsvorsitzende Gerd Nettekoven, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Patienten mit Krebs stehen in der Pandemie oft hintan. Wenn sich die Versorgung verschlechtert oder auch Diagnosen zu spät gestellt werden, schlägt sich das auch bei vielen Krebspatienten nieder, allerdings erst mit Verzögerung."
Nettekoven geht nun davon aus, "dass sich die Folgen der Pandemie für die Krebssterblichkeit ab Ende 2022 oder Anfang 2023 in den Todesstatistiken zeigen werden".
Das Statistische Bundesamt hatte zuvor berichtet, die Zahl der stationären Krebsbehandlungen habe sich im ersten Corona-Jahr 2020 um sechs Prozent auf 1,45 Millionen verringert. Zugleich gab es fünf Prozent weniger Krebsoperationen, wie die Statistiker anlässlich des Weltkrebstages an diesem Freitag mitteilten.
Laut Nettekoven war auch die Krebsfrüherkennung insbesondere zu Beginn der Pandemie stark betroffen. "Beispielsweise wurde das Mammografie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs im April 2020 kurzzeitig gänzlich ausgesetzt, um Kontakte zu vermeiden." Auch im weiteren Verlauf der Pandemie sind Untersuchungen zur Früherkennung von Krebs nach Einschätzung von Nettekoven nur zurückhaltend wahrgenommen worden, aus Angst, sich in Kliniken oder Praxen mit dem Coronavirus anzustecken. "Auch wollen viele Menschen das stark angespannte Gesundheitssystem nicht noch zusätzlich belasten und meiden deswegen den Klinik- oder Arztbesuch."
Starke Einschränkungen beobachtet die Krebshilfe nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden weiterhin zudem in der Nachsorge. "Aktuell findet etwa jede fünfte Nachsorgeuntersuchung nicht statt." Nettekoven rief dazu auf, vorgesehene Früherkennungsuntersuchungen unbedingt wahrzunehmen. "Auch bei unklaren Symptomen sollte man keinesfalls warten, sondern den Arzt aufsuchen", sagte er und versicherte zugleich: "Kliniken und Praxen treffen hohe Sicherheitsvorkehrungen und agieren sehr hygienebewusst."
Umfrage: 47 Prozent lehnen neue Zuschauergrenze in Fußballstadien ab
09:20 Uhr: 47 Prozent der Menschen in Deutschland lehnen es ab, dass bundesweit einheitlich wieder bis zu 10.000 Zuschauer in Fußballstadien dürfen. Nur 38 Prozent befürworten diese neue Zulassungsgrenze unter Einhaltung von 2G oder der 2G-plus-Regelung, 14 Prozent machten bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov keine Angabe. Ein gemeinsamer Beschluss der Staats- und Senatskanzleien lässt wieder bis zu 10.000 Zuschauer und Zuschauerinnen bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent bei Großveranstaltungen im Freien zu.
Auf Basis der YouGov Frage des Tages wurden am Donnerstag 1.587 Personen in Deutschland ab 18 Jahren befragt.
Höchststand: RKI meldet 248.838 Corona-Neuinfektionen
05:06 Uhr: Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Freitagmorgen 248.838 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 190.148 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1349,5 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1283,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1073,0 (Vormonat: 239,9). Die aktuellen Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Freitagmorgen, 05.00 Uhr, wieder.
Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.
Deutschlandweit wurden mach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 170 Todesfälle verzeichnet, genau so viel wie vor einer Woche. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 10.671.602 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.
Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 5,00 an (Mittwoch: 4,77). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.
Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitagmorgen mit 7.953.200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 118.504.
Hausärzteverband hofft auf mehr Impfungen durch Novavax
08:15 Uhr: Die Vorsitzende des Hausärzteverbands Brandenburg glaubt, dass der Novavax-Impfstoff der Impfkampagne neuen Schwung bringen wird. "Es gibt eine ganze Menge Leute, die sind nicht ideologisch oder sonst irgendwie stur, sondern die haben nicht wirklich selten Angst vor diesem mRNA-Impfstoff", sagte Karin Harre am Freitagmorgen im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb). "Auch wenn man sagt, der ist doch schon so oft verimpft worden. Aber wer erst einmal Angst hat, dem kriegt man das ja schlecht wieder ausgeredet." In ihrer Praxis gebe es einige Leute, die wirklich darauf warten würden, dass dieser andere Impfstoff komme und sich dann auch entspannter impfen lassen würden.
Der Novavax-Impfstoff soll ab dem 21. Februar in Deutschland ausgeliefert werden. Harre hofft, dass am 22. Februar nicht alle Patienten schon "auf der Matte stehen". Denn ob der Impfstoff dann schon in der Praxis sei, sei noch unklar.
AOK ruft zur Krebsvorsorge auf - Rückgang während Pandemie
07:14 Uhr: Der AOK-Bundesverband hat dazu aufgerufen, die Untersuchungen zur Krebsvorsorge auch während der Corona-Pandemie wahrzunehmen. "Das ist die einzige Chance, eine Erkrankung so früh wie möglich zu erkennen und zu behandeln. Das kann Leben retten", sagte Vorstandschefin Carola Reimann anlässlich des Weltkrebstags am Freitag.
Nach Angaben der AOK ist die Nachfrage nach der Früherkennung seit Beginn der Pandemie bei einigen Krebsformen phasenweise um bis zu 20 Prozent zurückgegangen. Insbesondere Männer nutzten die Früherkennungsangebote zu selten, einen Rückgang gebe es aber in fast allen Bereichen. Mediziner befürchteten daher einen Anstieg der Krebserkrankungen im fortgeschrittenen Stadium.
Reimann warb zudem dafür, dass sich Krebspatienten verstärkt an Spezialkliniken wenden. So habe es vor Corona fast 200 Krankenhäuser gegeben, die weniger als 20 Brustkrebs-Operationen pro Jahr durchgeführt hätten. Eine solche "Gelegenheitschirurgie" sei unverantwortlich, weil die nötige Routine fehle, kritisierte Reimann.
Patientenschützer: Corona-Bonus für Pflegekräfte "böses Erwachen"
04:00 Uhr: Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, hat den geplanten Corona-Bonus für Pflegekräfte kritisiert. Es sei ein "böses Erwachen für die 1,5 Millionen Pflegekräfte in Deutschland", sagte Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Der Pflegebonus sei nichts anderes als ein Steuerbonus. "Der Staat verzichtet auf Steuereinnahmen. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Arbeitgeber überhaupt zusätzlich bis zu 3.000 Euro pro Pflegemitarbeiter zahlen. Doch viele Krankenhäuser, Pflegeheime und ambulante Dienste werden dazu gar nicht in der Lage sein." Schließlich gehe es um bis zu 4,6 Milliarden Euro.
Die Bundesregierung will für den Corona-Bonus für Pflegekräfte eine Milliarde Euro bereitstellen. Mit dem vorgelegten Gesetz wird geregelt, dass diese Prämien bis zu einer Höhe von 3.000 Euro steuerfrei bleiben. Bei den Beschäftigten soll möglichst viel von dem Geld auch wirklich ankommen. Das gilt für Sonderzahlungen unter anderem für Mitarbeiter in Krankenhäusern, in der Intensivpflege, für ambulante Pflegekräfte und Beschäftigte in Pflegeheimen.
"Zwar bezeugt die Ampel im Koalitionsvertrag den Pflegekräften eine herausragende Leistung in der Pandemie. Doch Rot-Gelb-Grün ist nicht bereit, die Corona-Prämien selbst aufzubringen. So nimmt die Regierung in Kauf, dass viele Beschäftigte leer ausgehen", sagte Brysch. Die Regierung sollte stattdessen den Pflegebonus aus Haushaltsmitteln garantieren.
Das erste Mal seit zwei Jahren: Erste ausländische Touristen landen per Direktflug auf Bali
03:52 Uhr: Auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali sind erstmals seit der COVID-19-bedingten Grenzschließung vor fast zwei Jahren wieder ausländische Feriengäste mit einem Direktflug gelandet. Jedoch ließ sich der Neustart des Tourismus schleppend an: In der aus der japanischen Hauptstadt Tokio kommenden Maschine der Fluglinie Garuda Indonesia waren am Donnerstag nur sechs ausländische Urlauber und sechs Indonesier, wie die Zeitung "Jakarta Post" am Freitag berichtete. Gleichzeitig meldete die Regierung in dem Inselstaat mehr als 27.000 Corona-Neuinfektionen - so viele wie seit sechs Monaten nicht mehr.
Die Behörden hatten am Montag angekündigt, Bali am 4. Februar erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder für Touristen aus allen Ländern der Welt zu öffnen. Jedoch können sich Besucher nicht sofort frei auf der Insel bewegen: Wer vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze hat, muss fünf Tage in einem Hotel seiner Wahl in Quarantäne. Wer nur eine Erstimpfung hat, muss sich sieben Tage isolieren. Die Touristen dürften sich in dieser Zeit aber zumindest auf dem Hotelgelände bewegen und müssten nicht in ihren Zimmern bleiben, sagte Balis Tourismuschef Cokorda Pamayun.
Die Regierung entschied sich trotz seit Tagen steigender Corona-Zahlen aufgrund der ansteckenden Omikron-Variante für die Öffnung. Bali ist auf die wichtige Tourismus-Branche angewiesen, die seit April 2020 fast komplett am Boden liegt.
Saskia Esken: Müssen über zusätzliche Corona-Hilfen für Schüler nachdenken
02:01 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken hat zusätzliche Corona-Hilfen für Schülerinnen und Schüler ins Spiel gebracht. Das Aufholpaket von Bund und Ländern unterstütze zwar besondere Maßnahmen, um Bildungsrückstände aufzuholen. "Weil die Corona-Pandemie aber länger andauert und tiefere Spuren hinterlässt als gedacht, müssen wir darüber nachdenken, ob die überwiegend auf 2021/2022 befristeten Maßnahmen ausreichen", sagte Esken dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag). "Durch die Corona-Beschränkungen, aber auch durch Leistungsdruck und Zukunftsängste hat sich gerade bei jungen Menschen eine psychisch-mentale Belastung aufgebaut, die nicht ohne Antwort bleiben darf."
In einem offenen Brief von Schülervertretern, der im Netz unter dem Hashtag #WirWerdenlaut geteilt wird, werfen die Schülerinnen und Schüler der Politik derzeit vor, sie im Stich zu lassen. Sie fordern unter anderem Luftfilter in allen Schulen, kleinere Lerngruppen und PCR-Pooltests. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wertet die Initiative als Warnsignal an die politisch Verantwortlichen. "Es entsteht der Eindruck, dass Politik die Pandemie an den Schulen durchlaufen lässt - und damit die Gesundheit der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern gefährdet", sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem RND (Freitag).
RKI: 320.000 Arztbesuche wegen COVID-19 in einer Woche
01:00 Uhr: Das Robert-Koch-Institut schätzt die Zahl der Arztbesuche in Deutschland wegen Corona in der vergangenen Woche auf etwa 320.000. Die Werte der vierten Welle würden in fast allen Altersgruppen bereits deutlich überschritten, schreibt das RKI in seinem Wochenbericht von Donnerstagabend. Seit dem Jahreswechsel stieg die Arztbesuche-Zahl demnach, im Vergleich zur Vorwoche stagnierte sie, wobei Nachmeldungen noch möglich sind.
Nach RKI-Berechnungen waren in der Vorwoche 0,9 bis 1,8 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren an COVID-19 mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung erkrankt. Bei den Kindern bis 15 Jahre spricht das Institut von einem Betroffenen-Anteil von in etwa 1,6 bis 3,2 Prozent. Solche Berechnungen legt das RKI seit rund zwei Wochen vor - auch weil Labore und Gesundheitsämter bei der Erfassung von Infizierten am Limit sind und eine zunehmende Unvollständigkeit der Meldedaten angenommen wird.
Auch geschätzte Werte zu Krankenhausaufnahmen von mit SARS-CoV-2 infizierten Patientinnen und Patienten bewegten sich laut RKI "weiterhin auf hohem Niveau" und zeigten einen weiterhin leicht ansteigenden Trend (sogenannte adjustierte Hospitalisierungsinzidenz). Auf Intensivstationen zeige sich ein Anstieg durch die Omikron-Welle gegenwärtig nicht.
"Die 7-Tage-Inzidenz ist in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen im Alter von 5 bis 19 Jahren weiterhin am höchsten", sie sei aber auch in den älteren Altersgruppen teilweise wieder deutlich angestiegen, hält das RKI fest. "Die #Omikron-Welle kommt langsam bei der älteren Bevölkerung an", kommentierte die Behörde bei Twitter. Ein Anstieg auch bei den Älteren wird in Hinblick auf eine mögliche stärkere Belastung des Gesundheitssystems seit einiger Zeit befürchtet.
Unterdessen legt die offenbar noch besser übertragbare Omikron-Untervariante BA.2 in Deutschland auf niedrigem Niveau weiter zu. Für die Woche bis zum 23. Januar weist das RKI einen Anteil von 5,1 Prozent aus - rund eine Verdopplung im Vergleich zur Woche zuvor. Die Daten ergeben sich aus einer Stichprobe von Fällen, in denen vollständige Erbgutanalysen durchgeführt wurden. Demnach dominiert bisher in Deutschland der Omikron-Subtyp BA.1.
Mehr zum Themenkomplex Coronavirus:
- Das sind die wichtigen Begriffe der Coronavirus-Pandemie
- Gesammelte Faktenchecks rund um das Coronavirus und COVID-19
- Händewaschen: Diese Fehler gilt es zu vermeiden


"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.