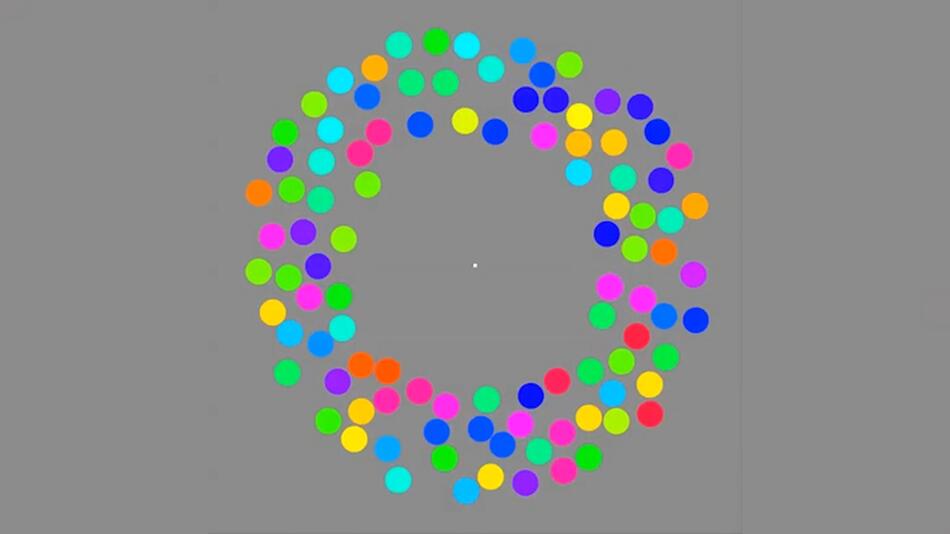Das Ebola-Fieber gehört zu den gefürchtetsten Seuchen der Welt. Wie gefährlich ist das Ebola-Virus? Und wie hoch ist das Risiko, dass es sich weltweit ausbreitet?
Was ist das Ebola-Virus?
Ebola-Viren gehören zur Familie der Filo-Viren, zu denen auch das gefährliche Marburg-Virus zählt. Der Name des Virus geht auf den Fluss Ebola in der Demokratischen Republik Kongo zurück, in dessen Ufernähe 1976 der erste große Ausbruch registriert wurde.
Fast zeitgleich kam es auch im Süden des Sudan zu einer Infektionswelle. Zunächst gingen Gesundheitsbehörden davon aus, dass es sich bei den beiden Ausbrüchen um ein einziges Ereignis handelte, das auf eine infizierte Person zurückzuführen ist. Später entdeckten die Wissenschaftler jedoch, dass die beiden Ausbrüche durch zwei verwandte, aber unterschiedliche Viren verursacht wurden: das Zaire- und das Sudan-Ebola-Virus.
Mittlerweile wurden drei weitere Arten von Ebola-Viren identifiziert, das Taï Forest-, das Bundibugyo- und das Reston-Ebola-Virus. Bis auf das Letztgenannte können alle Ebola-Viren-Arten beim Menschen sogenannte hämorrhagische Fiebererkrankungen (infektiöse Fiebererkrankungen, die häufig mit Blutungen auftreten) hervorrufen.
Bislang ist die Seuche ausschließlich auf den afrikanischen Kontinent südlich der Sahara beschränkt. Seit der Entdeckung 1976 sind Ausbrüche vor allem in Zentral- und Ostafrika aufgetreten, darunter wiederholt in der Demokratischen Republik Kongo, in Gabun, der Republik Kongo, im Südsudan und in Uganda. Die bislang schwerste Ebola-Epidemie ereignete sich 2014 bis 2016 in Westafrika: Damals verloren 11.310 Menschen in Guinea, Sierra-Leone und Liberia ihr Leben.
Wie wird das Ebola-Virus übertragen?
Übertragen wird das Virus durch direkten körperlichen Kontakt mit Ebola-Fieber-Patientinnen und -Patienten, Verstorbenen und infizierten Tieren. Nahe Angehörige, Pflegepersonal und Leichenbestatter haben in den betroffenen Regionen daher das höchste Ansteckungsrisiko.
Das Virus findet sich im Blut, Speichel und Schweiß von Infizierten, es lässt sich in Urin, Stuhl und Erbrochenem nachweisen. Auch eine Übertragung über kontaminierte Gegenstände, die mit Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen sind, ist möglich. Für eine Übertragung durch die Luft im Sinne einer Aerosolübertragung gibt es keine Hinweise.
Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich bei Ausbrüchen zunächst einzelne Menschen durch den Kontakt mit einem infizierten Wildtier mit dem Ebola-Virus anstecken und es sich dann von Mensch zu Mensch weiter ausbreitet. Flughunde und Fledermäuse gelten als natürlicher Wirt des Erregers, gesichert ist diese Annahme trotz intensiver Forschung in den betroffenen Gebieten bislang jedoch nicht.
Welche Symptome ruft eine Ebola-Virus-Infektion hervor?
Die ersten Symptome treten durchschnittlich acht bis zehn Tage nach Kontakt mit dem Ebola-Virus auf. Der Krankheitsverlauf beginnt zunächst mit "trockenen" und unspezifischen Symptomen, die denen einer Grippe- oder Malaria-Infektion ähneln. Dazu zählen:
- hohes Fieber
- starke Kopf- und Muskelschmerzen
- Halsschmerzen
- Abgeschlagenheit und Müdigkeit
- Appetitlosigkeit
- Schmerzen im Oberbauch
Im weiteren Krankheitsverlauf zeigen sich zunehmend "feuchte" Symptome wie:
- Durchfall und Erbrechen
- Rötung der Bindehaut
- Schluckbeschwerden
- innere und äußere Blutungen (Hämorrhagien)
- Organversagen
- Delirium
- Atemnot
Die diffusen inneren und äußeren Blutungen, die vor allem von den Schleimhäuten ausgehen, gelten als charakteristisch für die Erkrankung. Tatsächlich ist der beschriebene Krankheitsverlauf jedoch nicht rein Ebola-spezifisch. Auch Marburg-, Lassa- oder Krim-Kongo-Fieber-Viren können beim Menschen hämorrhagische Fieber auslösen, was die Diagnose für Ärzte erschwert.
Wie hoch ist die Letalitätsrate des Ebola-Virus?
Haben Patientinnen oder Patienten eine Infektion mit Ebola-Viren überstanden, ist ihr Leidensweg häufig noch nicht vorbei. Auch nach Genesung kann in Einzelfällen ein Post-Ebola-Syndrom mit verschiedenartigen Symptomen wie Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Sehstörungen auftreten.
Wie hoch die Sterblichkeitsrate ist, hängt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit dem verantwortlichen Virus-Typ zusammen. Beim Sudan-Ebola-Virus liegt die Sterblichkeit bei 50 Prozent, während beim Zaire-Ebola-Virus bis zu 90 Prozent der Erkrankten sterben. Angesichts dieser enorm hohen Sterblichkeitsraten gehören Ebola-Viren zu den gefährlichsten Erregern der Welt.
Gibt es eine Impfung oder Behandlung der Erkrankung?
Auch wie frühzeitig ein Patient oder eine Patientin medizinisch versorgt wird, hat enormen Einfluss auf die Überlebenschancen. Viele Virus-Erkrankungen können lediglich symptomatisch behandelt werden. Das war auch beim Ebola-Virus lange Zeit der Fall. Seit 2020 sind in den USA die Medikamente Inmazeb und Ebanga gegen das Zaire-Ebola-Virus zugelassen. Bei beiden Therapeutika handelt es sich um monoklonale Antikörper, die spezifisch auf das Zaire-Ebola-Virus zugeschnitten sind und den Erreger neutralisieren können.
Rund 90 Prozent der Patientinnen und Patienten können nach Angaben des RKI bei frühzeitigem Einsatz der Medikamente geheilt werden. Gegen die anderen Ebola-Virus-Typen gibt es bislang keine spezifische Therapie.
Gegen das Zaire-Ebola-Virus sind in der EU, den USA und einigen Ländern Afrikas mittlerweile zwei Impfstoffe zugelassen: Ein Lebendimpfstoff, der einmalig verabreicht wird, und ein Kombinationsimpfstoff. Die Wirksamkeit des Lebendimpfstoff beträgt nach Angaben des RKI 97,5 bis 100 Prozent und bietet offenbar auch Personen, die bereits Kontakt mit dem Virus hatten, einen gewissen Schutz.
Bei Personen, die trotz Impfung erkrankten, wurde ein in der Regel milderer Krankheitsverlauf beobachtet. Der Kombinationsimpfstoff besteht aus zwei verschiedenen Vektorimpfstoffen und darf im Gegensatz zum Lebendimpfstoff auch Kindern ab dem ersten Lebensjahr verabreicht werden. Wie lange die Wirkung der Impfstoffe anhält, ist nicht bekannt.
Könnte sich das Ebola-Virus auch über den afrikanischen Kontinent hinaus ausbreiten?
Dass sich das Ebola-Virus bislang nicht über den afrikanischen Kontinent hinaus zu einer globalen Pandemie ausgebreitet hat, liegt unter anderem daran, dass die Infizierten vor Symptombeginn in der Regel nicht ansteckend sind. Dadurch können infizierte Personen leichter identifiziert und isoliert werden, bevor das Virus auf andere Personen übertragen wird. Darüber hinaus verlaufen Ebola-Infektionen oft rasch, sodass viele Infizierte innerhalb weniger Tage nach Ausbruch der Erkrankung sterben.
Nach Ansicht des RKI ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich das Ebola-Virus auch in Deutschland ausbreitet, da es nicht natürlicherweise in der Umwelt vorkommt. Zwar könne nicht ausgeschlossen werden, dass im Einzelfall eine infizierte Person während der Inkubationszeit nach Deutschland einreisen könnte. Der Ebola-Ausbruch 2014/15 in Westafrika habe allerdings gezeigt, dass das Risiko der Einreise eines Infizierten selbst dann sehr gering ist, wenn afrikanische Großstädte mit internationalen Flugverbindungen von einem Ausbruch betroffen sind.
Damals hätten nur vereinzelt infizierte Personen die betroffenen Länder mit dem Flugzeug verlassen können. Zwar seien daraufhin einzelne Fälle in den USA und Europa registriert worden, zu einer weiteren Ausbreitung des Virus kam es jedoch nicht.
Verwendete Quellen
- dw.com: Ebola-Ausbruch in Uganda zu Ende
- Center for Disease Control and Prevention: "2014-2016 Ebola Outbreak Distribution in West Africa"
- Center for Disease Control and Prevention: "What is Ebola Disease?”
- Deutsches Ärzteblatt: "Post-Ebola-Syndrom häufiger als erwartet”
- Center for Disease Control and Prevention: "Signs and Symptoms"
- RKI: Antworten und häufig gestellte Fragen zum Ebola-Fieber